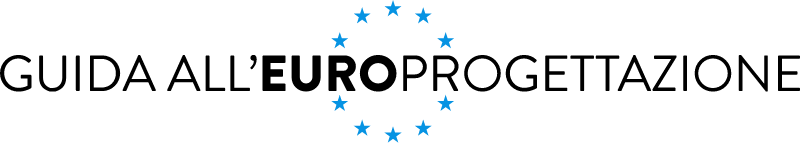Wir feiern Halloween, indem wir über einige der häufigsten Fehler sprechen, die unsere Projekte in „Monster“ verwandeln können.
Europäische Projekte: Sind die „Monster“ unter uns?
Es ist schwierig, eine Idee in ein erfolgreiches und realisierbares Projekt zu verwandeln. Deshalb stellen wir im Planungsteil des Leitfadens Hilfsmittel und Tipps zur Verfügung und haben kürzlich eine Reihe von Anleitungsvideos veröffentlicht (Sie finden sie im Leitfaden und auf YouTube).
Manchmal kommen die Probleme von außen: komplexe Aufforderungen mit vielen Anforderungen, wenig verfügbare Zeit, knappe Fristen. Zu anderen Zeiten oder zusätzlich liegen die Probleme in der Konzeption: oberflächliche Kontextanalyse, zu allgemein formulierte Ziele, unzureichende Zeit- oder Finanzplanung.
Eine ineffektive Planung kann zu echten ‚Monstern‘ führen, und darüber wollen wir an diesen Halloween-Tagen mit Ihnen sprechen. Wir geben Ihnen nicht nur Beispiele, sondern auch einige Stichworte und Tipps, wie Sie „Ungeheuerlichkeiten“ vermeiden und ein Projekt entwickeln können, das eine gute Chance hat, finanziert zu werden und seine Ziele zu erreichen.
Dies ist der zweite Artikel in unserer Serie über Designfehler (den ersten, über organisatorische Kapazitäten, finden Sie hier). Wir werden sie in den kommenden Monaten fortsetzen.
Der Zombie: eine Designidee, die aus der Vergangenheit wiederauferstanden ist und nicht mehr relevant ist
Schlüsselwort: Aktualität.
Beginnen wir mit einem häufigen Fehler: Wem ist es noch nie passiert, dass er beim Schreiben eines Projekts Ideen aus der Vergangenheit aus der Schublade gezogen hat? Aktivitäten, die ‚tot und begraben‘ schienen und stattdessen wiederbelebt und für einen neuen Aufruf eingereicht werden?
Das Heranziehen früherer Projekte hat auch seine positiven Seiten: Es spart Zeit bei der Planung und beim Schreiben von Projekten. Wenn Sie strategisch vorgehen, können Sie Ideen, die funktioniert haben, an neue Kontexte anpassen oder solche, die nicht funktioniert haben, verbessern. Es ist normal und nützlich, Ideen in der Schublade zu haben oder sie ‚einzufrieren‘, während man darauf wartet, dass die Zeit reif ist oder eine geeignete Ausschreibung kommt.
Aber hüten Sie sich vor dem Zombie-Effekt: Die Bedürfnisse, die wir mit unserem Projekt ansprechen wollen, könnten sich seit der Vergangenheit geändert haben und die Aktivitäten könnten nicht mehr angemessen sein; oder die Idee könnte einfach nicht für den neuen Kontext geeignet sein. In diesem Kapitel finden Sie einige Hinweise dazu, wie Sie eine Kontextanalyse, z.B. eine Akteurskartierung und eine Bedarfsanalyse, durchführen und dabei den ‚Zombie-Effekt‘ vermeiden können.
Wenn das Projekt, das wir mit diesen Ideen und Aktivitäten vorgestellt haben, keine Finanzierung erhalten hat, sollten wir uns fragen, warum das passiert ist. Lesen wir noch einmal die Bewertungen, die wir von der Finanzierungsstelle erhalten haben, und denken wir über die Gültigkeit dieser Idee und Aktivität im Hier und Jetzt nach. Hüten Sie sich also vor dem Copy-and-Paste-Effekt und dem Risiko, unkritisch Fehler zu wiederholen, die verhindert haben, dass unser früheres Projekt finanziert wurde oder gut funktionierte.
Denken wir daran, dass es zwar nicht notwendig ist, das Rad jedes Mal neu zu erfinden, dass Design aber auch eine Möglichkeit ist, kreative Lösungen anzuregen: Wenn wir zu sehr in der Vergangenheit „fischen“, könnte das die Innovationsfähigkeit unserer Organisation einschränken.
Unser Rat? Nicht „exhumieren“, sondern „regenerieren“: Analysieren Sie das Projekt ausgehend vom Kontext, indem Sie die veralteten Teile verwerfen und die Elemente beibehalten, die für die heutigen Bedürfnisse noch relevant sind, und integrieren Sie die neuen Elemente. Auf diese Weise wird das Erbe eines vergangenen Projekts aufgewertet und mit neuem Leben erfüllt.
Der Replikant: der Projektvorschlag, der wahllos in mehreren Aufrufen zur Einreichung von Vorschlägen eingereicht wurde
Schlüsselwort: Authentizität.
Ähnlich wie beim Zombie-Effekt kommt es manchmal vor, dass dieselben Projektideen wahllos in mehreren Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen verwendet werden, um (zumindest theoretisch) die eigenen Chancen auf eine Finanzierung zu maximieren.
Diese Methode ermöglicht eine Optimierung des Entwurfsaufwands, aber jede europäische Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen ist eine Welt für sich: Das Kopieren eines Projekts (oder eines Teils davon) ohne die notwendigen Anpassungen birgt das Risiko, dass man sich nicht an die spezifischen Anforderungen, Themen und Ansätze der Aufforderung hält, was die Chancen auf eine gute Bewertung und eine Finanzierung des eigenen Projekts drastisch verringert.
In einigen Fällen enthalten die Ausschreibungen eine Klausel, die Projekte disqualifiziert, die bereits im Rahmen anderer Programme eingereicht oder finanziert wurden. Gegenkontrollen sind eine weit verbreitete Praxis und es besteht die Gefahr, dass das eigene Projekt disqualifiziert wird.
Aber es gibt auch Risiken, wenn unser Projekt über mehr als eine Ausschreibung finanziert wird: Wenn es sich um dasselbe Projekt handelt, besteht möglicherweise das Risiko einer „Doppelfinanzierung“ (die wir hier ebenfalls erörtert haben), d.h. die Angabe derselben Kosten bei mehreren Finanzierungsquellen. Diese Praxis kann zum Entzug der Finanzierung, zu Sanktionen oder im schlimmsten Fall zu rechtlichen Schritten führen.
All dies kann zu einem Reputationsschaden für die Organisation gegenüber den Geldgebern führen, der weitaus schwerwiegender ist als die Tatsache, dass ein einziges Projekt nicht finanziert wird.I
UNSER RAT? Anpassen, nicht kopieren: Verwenden Sie den ursprünglichen Vorschlag als Ausgangspunkt, aber passen Sie das Projekt so an, dass es mit den Zielen, Bewertungskriterien und der spezifischen Sprache der jeweiligen Ausschreibung übereinstimmt.
Frankenstein: die Zusammenstellung von widersprüchlichen Ideen oder Komponenten früherer Projekte
Schlüsselwort: Konsistenz.
Eine weitere typische Design-Monstrosität ist der ‚Frankenstein-Effekt‘, der auftritt, wenn ein Projekt durch die mehr oder weniger wahllose Kombination von Teilen anderer Projekte entsteht und dabei die interne und externe Kohärenz geopfert wird. In diesem Fall überwiegen die Vorteile bei weitem die Risiken, denn auch wenn wir Zeit sparen und Aktivitäten einbeziehen können, die wir bereits ausprobiert haben, kann die Gültigkeit des Projekts durch die fehlende Kohärenz ernsthaft beeinträchtigt werden. Dies verringert nicht nur die Möglichkeit einer Finanzierung erheblich, sondern führt auch zu ernsthaften Problemen bei der Umsetzung, die zum Scheitern des Projekts führen können.
Die verschiedenen Komponenten (Aktivitäten, Methoden, Ziele, Ergebnisse) werden im Rahmen von Projekten mit einem Zweck, einem Ziel und einem kohärenten Design entwickelt: Wenn man sie unbedacht vermischt, ist das Risiko groß, dass sie nicht kohärent integriert werden und sogar miteinander in Konflikt geraten können. Wir sparen vielleicht Zeit in der Entwurfsphase, aber indem wir die Kohärenz des Projekts verringern, untergraben wir seinen Wert erheblich. Und selbst wenn das Projekt finanziert wird, besteht die Gefahr, dass wir in der Umsetzungsphase Energie verschwenden, indem wir versuchen, unvereinbare Elemente zueinander zu bringen.
Unstimmigkeiten können auch auf der Ebene der Ziele auftreten, die möglicherweise nicht klar sind: Das Projekt ist ein System, in dem jedes Element auf verschiedenen Ebenen zu einer gemeinsamen Vision und Logik beiträgt, die dazu dienen, das Projekt wirksam nach außen zu kommunizieren.
Unser Rat? Gehen Sie nicht ‚von den Teilen zum Ganzen‘, sondern ‚vom Ganzen zu den Teilen‘: Definieren Sie klar die übergeordnete Vision und die Ziele des Projekts. Filtern Sie Teile aus anderen Projekten heraus und fragen Sie sich, ob dieser Teil mit der internen (Ziele und Aktivitäten) und externen (Ergebnisse und Vision) Vision des Projekts vereinbar ist. Sie können sich mit Tools wie dem Logical Framework helfen, um die Kausalkette zwischen den Komponenten zu überprüfen.
Der Blob-Fisch: Das Projekt lässt sich nur schwer wiederholen und an andere Kontexte anpassen
Schlüsselwort: Anpassungsfähigkeit.
Stellen wir uns vor, wir haben ein Projekt entwickelt, das perfekt auf eine Ausschreibung zugeschnitten ist. Unser Projekt hat eine viel bessere Chance, finanziert zu werden und effektiv zu sein als andere Projektvorschläge, denen es vielleicht an Spezifität fehlt.
Aber wenn der Fokus des Projekts zu eng gefasst ist, kann es sehr schwierig sein, die Erfahrung zu wiederholen und sie an andere Kontexte oder unvorhergesehene Ereignisse anzupassen. Unser Projekt droht das traurige Ende des Blobfisches zu nehmen: ein Tier, das in der Tiefsee lebt. In seiner natürlichen Umgebung fühlt er sich wohl und hat ein durchaus ansehnliches Aussehen, aber wenn er an die Oberfläche gebracht wird, verändert er sich aufgrund des abnehmenden Wasserdrucks völlig und nimmt ein schlaffes, gallertartiges Aussehen an.
Jedes Projekt, auch wenn es einzigartig ist, muss ein gewisses Maß an Anpassungsfähigkeit, Nachhaltigkeit und Replizierbarkeit aufweisen: sowohl für die Organisation, die ihr Geschäft mit den Projekten ausbauen möchte, als auch für die Finanzierungseinrichtung, die ihre Ressourcen effektiv nutzen und sich auf Projekte konzentrieren möchte, die über den Finanzierungszeitraum hinaus „weiterleben“ und sich möglicherweise anpassen können, um auf neue Herausforderungen zu reagieren. Hüten Sie sich auch vor dem Risiko der „vorzeitigen Alterung“: Ein zu spezifisches Projekt läuft Gefahr, sich im Laufe der Zeit weniger gut an Veränderungen im Umfeld anpassen zu können.
Unser Rat? Verwenden Sie einen modularen Ansatz: Entwickeln Sie ein Projekt, bei dem die grundlegenden Elemente, insbesondere die Aktivitäten, als in sich geschlossene Module konzipiert sind, mit Elementen, die standardisiert und in andere Kontexte exportiert werden können, und konzentrieren Sie sich dabei nicht nur auf den Inhalt, sondern auch auf die Verwendung replizierbarer Methoden.
Die Mumie: die starre Designstruktur mit wenig Handlungsspielraum
Schlüsselwort: Flexibilität.
Ein Projekt ist eine Reihe von Prozessen und Aktivitäten, die von drei miteinander verknüpften Variablen (der so genannten dreifachen Einschränkung) abhängen: Umfang, Kosten und Zeit. Wenn Sie eine dieser Variablen ändern, müssen Sie die anderen entsprechend anpassen. So kann beispielsweise eine Erhöhung der Anzahl der Zielgruppen, die sich auf den Umfang auswirkt, zu einer Verlängerung der Projektdauer führen und/oder eine Aufstockung der Ressourcen erfordern. Daher ist es bereits in der Planungsphase wichtig, eine gewisse Flexibilität zu bewahren.
Ein gewisses Maß an Präzision ist sicherlich hilfreich: Genaue und präzise Kostenschätzungen im Budget helfen, das Projekt besser zu managen und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass die Kosten während der Umsetzung mit dem übereinstimmen, was geplant war. Viele Risiken können durch eine kristallklare Rollenverteilung vermieden werden, und eine lineare Ausführung der Aktivitäten sorgt dafür, dass der Fokus auf den Zielen und Ergebnissen bleibt.
Aber wenn unser Projekt unelastisch ist, wird es auch schwieriger sein, es an Veränderungen im Kontext, an neue Herausforderungen oder an neue Chancen, die sich ergeben, anzupassen. Zu viel Kontrolle kann das Projekt weniger dynamisch machen und die Fähigkeit zur Anpassung und zum Lernen einschränken. Es ist normal, dass sich einige der in der Konzeptionsphase erdachten Lösungen in der Umsetzungsphase nicht als wirksam erweisen: Wenn der Ansatz nur auf die getreue Ausführung von Aktivitäten ausgerichtet ist, besteht die Gefahr, dass etwas, das nicht funktioniert, weitergeführt wird, wodurch das Erreichen der Ziele und Ergebnisse oder das Aufkommen besserer Lösungen behindert wird. Je länger eine kritische Angelegenheit aufrechterhalten wird, desto mehr steigen die Kosten und die Schwierigkeiten bei der Suche nach einer Lösung. Das Streben nach formaler Perfektion, d.h. der Wunsch, ein Projekt genau wie geplant durchzuführen, kann dazu führen, dass die Bedürfnisse, für die das Projekt konzipiert wurde, nicht erfüllt werden. Aus diesem Grund gibt es Überwachungs- und Bewertungsaktivitäten: um aus der Starrheit auszubrechen und die notwendigen Änderungen vorzunehmen, um den substantiellen Erfolg des Projekts zu gewährleisten.
Unser Rat? Stellen Sie sich das Projekt nicht als Käfig, sondern als Panzer vor: Es muss starr genug sein, um nicht auseinanderzufallen, aber flexibel genug, um Erschütterungen standzuhalten. Entwickeln Sie die Aktivitäten nicht als eine ununterbrochene Kette, sondern so, dass sie in unterschiedlichen und autonomen Phasen mit eigenem Budget und definierten Zeitplänen organisiert sind, so dass ein negatives Ereignis in einer Aktivität die geringstmöglichen Auswirkungen auf die anderen hat. Planen Sie bei der Festlegung von Zeit und Kosten einen Spielraum ein und nehmen Sie, wenn möglich, einen Betrag für Unvorhergesehenes in das Budget auf.
Hand: die Projektidee, die mit einer einzelnen Aktivität oder Komponente übereinstimmt
Schlüsselwort: Komplexität.
Es kann vorkommen, dass sich eine Organisation an europäische Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen wendet, um eine bestimmte Aktivität zu finanzieren, zum Beispiel ein Festival oder einen Workshop. Aber wenn wir kein Projekt wollen, das der ‚Hand‘ der Addams Family ähnelt, müssen wir der Versuchung widerstehen, uns ausschließlich auf unsere unmittelbaren Bedürfnisse zu konzentrieren und einen umfassenderen Projektvorschlag zu entwickeln.
Ein Projekt mit nur einer Aktivität oder Komponente kann Vorteile in Bezug auf Verwaltung und Übersichtlichkeit haben. Aber diese Vereinfachung geht fast immer mit einer eingeschränkten Fähigkeit einher, eine langfristige Wirkung zu erzielen, was das Hauptziel der Finanzierungseinrichtungen ist. Die Anpassungsfähigkeit, die wir oben erörtert haben, ist bei einem Projekt, das sich auf eine einzige Aktivität beschränkt, stark gefährdet.
Bei einem allzu elementaren oder „Einheits“-Projekt gibt es nur begrenzte Lernmöglichkeiten und (paradoxerweise) ist man bestimmten Risiken stärker ausgesetzt. Obwohl eine geringere Komplexität weniger Risiken mit sich bringt, kann in einem solchen Rahmen ein einziges Risiko (z.B. die Absage der Veranstaltung) ausreichen, um fatale Auswirkungen auf das Projekt zu haben.
Europäische Ausschreibungen belohnen Projekte, die eine strategische Vision haben und in der Lage sind, Lösungen für komplexe Probleme vorzuschlagen, was bei Projekten, die aus einer einzigen Komponente oder sogar einer einzigen Aktivität bestehen, kaum der Fall ist.
Der Begriff ‚Komplexität‘ leitet sich von dem lateinischen Verb ‚umarmen, zusammenhalten‘ ab: Im Design bedeutet er, dass man ein Projekt aus mehreren funktionalen Elementen zusammenstellen kann, die für ein gemeinsames Ziel zusammenkommen. Und vergessen wir nicht, dass ein ‚komplexes‘ Projekt nicht gleichbedeutend mit einem ‚komplizierten‘ Projekt ist.
Unser Rat? Betrachten Sie die einzelne Aktivität als die Spitze eines Eisbergs: Die zentrale Aktivität kann das sichtbarste Element des Projekts bleiben, aber sie muss durch andere Aktivitäten mit einer breiteren Vision unterstützt werden, die ihre Wirkung verstärkt. Schlagen Sie beispielsweise nicht nur die Veranstaltung vor, sondern auch die Strategie, die die Veranstaltung notwendig macht, um auf die ermittelten Bedürfnisse zu reagieren, gegebenenfalls einschließlich Forschungsaktivitäten, Analysen, Replizierbarkeit. Ziehen Sie auch die Möglichkeit in Betracht, die Veranstaltung in ein Projekt einzubinden, das mit anderen Partnerorganisationen aufgebaut werden soll(hier und in der Videopille finden Sie einige Ideen für die Schaffung effektiver Partnerschaften und hier einen ausführlichen Blick auf Partnerschaftsvereinbarungen).
Vom Monster zum Siegerprojekt
Wir haben uns durch die Design-Albträume gewühlt und versucht, Ihnen Denkanstöße zu einigen der Ansätze zu geben, die Ihre Chancen einschränken können, Projekte zu schaffen, die eine Finanzierung erhalten und vor allem einen dauerhaften Wert schaffen. Ein erfolgreiches und wirkungsvolles Projekt ist immer:
- aktuell, d.h. an den aktuellen Bedürfnissen und Herausforderungen orientiert
- authentisch, auf der Grundlage der ermittelten Bedürfnisse und einer Reflexion über den Aufruf konzipiert
- kohärent, mit internen Elementen (Ziele, Aktivitäten), die zu einer gemeinsamen Vision beitragen
- anpassungsfähig, so dass es mit einem modularen Ansatz in anderen Kontexten implementiert werden kann
- flexibel, elastisch genug, um Erschütterungen standzuhalten und notwendige Änderungen zu berücksichtigen
- komplex, d.h. als System mit einer strategischen Vision und langfristiger Wirkung konzipiert
Das ist keine leichte Aufgabe, aber wenn wir diese Kriterien beachten, können wir den ‚Monstereffekt‚ vermeiden.
Und Sie, sind Sie in Ihrer Designerfahrung schon einmal mit einem dieser „Monster“ konfrontiert worden? Welches davon ist am schwierigsten zu besiegen?