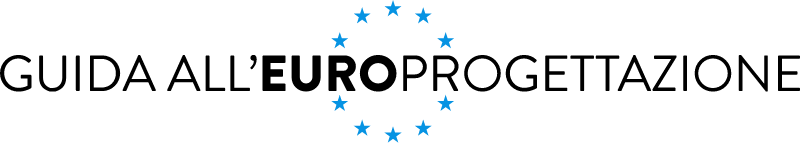Top-down- und Bottom-up-Aufrufe: Lernen Sie sie besser kennen, um den für unsere Projektidee am besten geeigneten Aufruf auswählen zu können
Von der „Einkaufsliste“ zum Projekt: Top-down- und Bottom-up-Ansatz bei europäischen Ausschreibungen
Ein erfolgreiches Projekt beginnt mit der Auswahl der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen. Der Ausgangspunkt ist sicherlich, sich über die Finanzierungsmöglichkeiten auf dem Laufenden zu halten, indem Sie die Aktualisierungen auf den Websites der verschiedenen EU-Programme und anderen speziellen Portalen verfolgen, wie z. B. unser Portal für Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen, das monatlich aktualisiert wird.
Aber zu wissen, welche Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen zur Verfügung stehen, ist nur der erste Schritt: Der nächste Schritt besteht darin, unter den vielen Möglichkeiten zu verstehen, welche am besten zu unserer Projektidee passen. In diesem Artikel erörtern wir die Top-Down- und Bottom-Up-Ansätze in europäischen Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen, wie sie den Flexibilitätsgrad einer Aufforderung bestimmen, und Strategien für die Entwicklung von Projekten im Einklang mit jedem der beiden Ansätze.
Wenn man einen Handlungsaufruf mit einer‚Einkaufsliste‚ vergleicht, ist es so, als ob wir aufgefordert werden, ‚Milch, Brot und Eier‘ zu kaufen, wobei wir die Freiheit haben, die Marke der Milch oder die spezifische Brotsorte zu wählen oder vielleicht, warum nicht, das Brot durch Cracker zu ersetzen, solange das Ziel ‚frühstücken‘ erreicht wird; oder wenn wir aufgefordert werden, einen Liter Milch einer bestimmten Marke, zweihundert Gramm Roggenbrot und sechs Bio-Eier zu kaufen. In dem einen Fall (allgemeine Angaben) befinden wir uns in einem Bottom-up-, d.h. von unten nach oben gerichteten Ansatz; in dem anderen Fall (detailliertere Liste) befinden wir uns in einem Top-down-, d.h. von oben nach unten gerichteten Modus.
Es gibt keinen Weg, der besser ist als der andere, denn jede Einkaufsliste entspricht, genau wie der Top-Down- und der Bottom-Up-Ansatz, unterschiedlichen Bedürfnissen und Methoden: Im einen Fall, bei der detaillierten Liste, beginnt man zunächst mit der Übersicht, z.B. dem Menü der Woche, und legt dann die einzelnen Zutaten im Vorfeld fest, während bei der anderen das Hauptziel, das Frühstück, im Vordergrund steht und mehr Auswahl und die Möglichkeit, ein Lebensmittel durch ein ähnliches zu ersetzen, bleibt.
Wenn wir uns vorstellen, dass die Person, die die Einkaufsliste geschrieben hat, der Geldgeber ist und die Person, die tatsächlich einkaufen geht, die Organisation/Einrichtung ist, die ein Projekt vorstellt, können wir leicht erraten, welche Konsequenzen, Einschränkungen und positiven Aspekte die Verfolgung des einen Ansatzes gegenüber dem anderen haben könnte.
Bevor wir uns mit den beiden Ansätzen befassen, sollten Sie bedenken, dass in den europäischen Politiken, Programmen und Aufrufen zur Einreichung von Vorschlägen zwar häufig von Top-down- und Bottom-up-Ansätzen die Rede ist, es aber keine allgemein gültige offizielle Definition gibt. In der Tat werden je nach Programm und Aktionsbereich (Forschung, lokale Entwicklung, Bildung usw.) unterschiedliche Aspekte und Nuancen betont.
Dies ist beispielsweise bei der Definition der beiden Ansätze im Leitfaden von Horizon Europe durch APRE der Fall, wo die Merkmale von Top-Down und Bottom-Up je nach den Besonderheiten des Forschungs- und Innovationssektors dekliniert werden. Der Bottom-up-Ansatz wird auch als ’neugiergetrieben‘ bezeichnet und bezieht sich hauptsächlich auf die Grundlagen- und Pionierforschung.
Im Rahmen der Strukturfonds(ESF+ und EFRE) wird der Bottom-up-Ansatz stattdessen (und nicht in Bezug auf die Innovationskraft) mit dem Begriff „partizipative lokale Entwicklung“ definiert. Definiert in der Verordnung (EU) 2021/1060 (Artikel 28 und 31-34), handelt es sich um eine Methode der Planung, Programmierung und Umsetzung, bei der die zu finanzierenden Prioritäten, Ziele und Maßnahmen von den lokalen und regionalen Akteuren (Verwaltungen, Wirtschafts- und Sozialpartner, Zivilgesellschaft) ermittelt, vorgeschlagen und inhaltlich definiert werden.
Unter Berücksichtigung dieser wichtigen Prämisse wollen wir uns daher mit jedem der beiden Ansätze näher befassen und eine Ausgangsdefinition, die positiven und die schwierigeren Aspekte, einige Tipps und Beispiele für europäische Referenzaufrufe liefern.
Der Top-Down-Ansatz
Wie wir gesehen haben, beginnt der Top-Down-Ansatz mit der allgemeinen Übersicht, dem ‚Menü‘, und geht dann von oben nach unten mit zunehmender Detailtiefe vor. Das bedeutet, dass bei einem solchen Aufruf Folgendes ermittelt wird:
- die Ziele (allgemein und spezifisch) und das Problem, zu dessen Lösung die eingereichten Projekte beitragen sollen;
- eine Liste von Themen, Schwerpunkten und Zielgruppen für die Intervention;
- eine Liste verbindlicher erwarteter Ergebnisse (Outputs und Outcomes), in einigen Fällen mit Leistungs- und Wirkungsindikatoren, die bereits in der Aufforderung aufgeführt sind;
- eine mehr oder weniger detaillierte Liste der förderfähigen Maßnahmen, manchmal verbunden mit weiteren Einschränkungen (z.B. maximales Budget pro Art von Aktivität).
Positive Aspekte und Grenzen des Top-Down-Ansatzes
Der Top-Down-Ansatz ist in den meisten europäischen Ausschreibungen zu finden. Er hat eine Reihe von Vorteilen:
- Es fördert die Kohärenz zwischen den geförderten Projekten und den EU-Strategien. Die Fragen und Probleme, zu deren Lösung das Projekt beitragen muss, sind klar definiert, so dass eine Abstimmung gewährleistet ist;
- Dank spezifischer Überwachungsindikatoren (KPIs) ermöglicht es eine bessere Kontrolle der erwarteten Ergebnisse. Auch aus diesem Grund ist es ein nützlicher Ansatz für die effektive Verwaltung komplexer und groß angelegter Projekte, an denen viele verschiedene Maßnahmen und Akteure beteiligt sind;
- Es wird klar definiert, was von den Projekten erwartet wird und welche Anforderungen gestellt werden, so dass die vorschlagenden Organisationen von Anfang an verstehen können, was genau die Erwartungen der Finanzierungsstelle sind.
Auch dieser Ansatz hat seine Grenzen:
- Ein Mangel an Flexibilität, der den Innovationsgrad der Projektvorschläge einschränken kann;
- Es besteht die Gefahr, den Bezug zur lokalen Dimension und den Herausforderungen der einzelnen Gebiete zu verlieren;
- Das Risiko, dass sich eine bestimmte Sichtweise von Problemen und Lösungen als teilweise oder ganz ungenau erweist und zu schlechten Ergebnissen oder negativen externen Effekten führt.
Annäherung an eine Top-Down-Ausschreibung
Wenn Sie einen Top-Down-Aufruf in Angriff nehmen, müssen Sie sorgfältig analysieren, ob die Projektidee den Anforderungen des Aufrufs entspricht. Die folgenden Fragen müssen gestellt werden:
- Stimmen die Ziele meiner Idee mit den Zielen des Aufrufs überein oder weichen sie davon ab (und in welchem Maße)?
- Fällt der Themenbereich meines Vorschlags unter die Vorgaben der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen?
- Trägt mein Projekt auf direkte und messbare Weise zu den erwarteten Ergebnissen bei, die in der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen genannt werden? Wird mein Projekt diese Ergebnisse garantieren können?
- Passt meine Projektidee zu der Art der erforderlichen Maßnahmen?
Ein Projekt ist besonders geeignet für einen Top-Down-Aufruf, wenn:
- Die Idee wurde unabhängig von der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen entwickelt, aber ihre Ziele, ihr Sektor und die angestrebten Ergebnisse entsprechen den Anforderungen der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen. In diesem Fall führt die Anpassung des Projekts an die Ausschreibung nicht zu einer Verzerrung der Projektidee;
- Die Idee ist spezifisch und hat die Form der in der Aufforderung geforderten Aktionen;
- Die vorschlagende Organisation ist in der Lage, einen Vorschlag zu erstellen, der alle Anforderungen und Auflagen erfüllt, auch die formalen (z. B. die Anzahl der zu beteiligenden Partner, die Höhe der Kofinanzierung usw.), die in der Aufforderung gefordert werden.
Der Bottom-up-Ansatz
Beim Bottom-up-Ansatz hingegen ist das Gesamtziel der Aufforderung sehr klar, während bei der Definition, wie das Ziel erreicht werden soll, mehr Spielraum bleibt. Das bedeutet, dass eine solche Aufforderung:
- bietet einen allgemeinen Rahmen strategischer Prioritäten und allgemeiner Ziele, lässt aber mehr Freiheit und Autonomie bei der Definition des zu lösenden Problems und der spezifischen Ziele des Projekts;
- hat einen weniger eingeschränkten Geltungsbereich: Er kann thematische Makrobereiche vorsehen, ohne jedoch Unterthemen oder spezifische Themen anzugeben. In einigen Fällen sieht er keine thematischen Einschränkungen vor. Die Zielgruppe ist breiter definiert und unterliegt weniger Einschränkungen;
- enthält keine Liste verbindlicher erwarteter Ergebnisse. Es obliegt dem Antragsteller, diese glaubwürdig und messbar darzulegen und dabei die spezifischen Auswirkungen und vorgeschlagenen Indikatoren zu erläutern;
- gewährt eine große Flexibilität bei der Definition von Aktivitäten und Ressourcen, die nur durch die Übereinstimmung mit dem vorgeschlagenen Ziel begrenzt wird, mit wenigen Einschränkungen in Bezug auf das Budget und die förderfähigen Kosten.
Positive Aspekte und Grenzen des Bottom-up-Ansatzes
Der Bottom-up-Ansatz ist in den europäischen Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen weniger präsent, wird aber in einigen Bereichen wie der Grundlageninnovation, der Pionierforschung und der Bürgerbeteiligung angewandt, wo er einige wichtige Vorteile hat:
- Die Möglichkeit, transformative Ideen und Lösungen zu sammeln und spontane Innovationen freizusetzen (Aspekte, die nicht „von oben“ geplant werden können);
- Die größere Möglichkeit der Anpassung und Relevanz an lokale Bedürfnisse oder an spezifischere Sektoren;
- Die Möglichkeit, Exzellenz durch die Finanzierung von Projekten mit einem Höchstmaß an Kreativität zu würdigen, unabhängig von thematischen oder konzeptionellen Beschränkungen;
- Der höhere Grad an Inklusivität, mit der Möglichkeit der Finanzierung von Organisationen, wie z.B. kleinen und mittleren Unternehmen, denen der Zugang zu Top-Down-Ausschreibungen oft erschwert wird.
Selbst beim Bottom-up-Ansatz gibt es einige Einschränkungen und Herausforderungen:
- Das Risiko einer schwierigeren strategischen Ausrichtung und Kohärenz der Projekte mit der europäischen Politik;
- Die Schwierigkeit, die Gesamtwirkung einer Aufforderung zu messen, die sich über mehrere Initiativen und Themenbereiche erstrecken kann, mit uneinheitlichen Indikatoren zur Messung der Wirkung;
- Die größere Komplexität der Bewertung von Projektideen, die sehr unterschiedlich sein können;
- ein größerer Aufwand für die Definition des Problems, der spezifischen Ziele und der Ergebnisindikatoren, Elemente, die bei Top-Down-Aufrufen bereits weitgehend umrissen sind;
- Es besteht die Gefahr, dass der Wettbewerb sehr hoch ist, gerade weil Ausschreibungen, die thematisch weniger eng gefasst sind, leichter zugänglich sind.
Annäherung an eine Ausschreibung von unten nach oben
Das Vorgehen bei einem Bottom-up-Aufruf mag nur auf den ersten Blick einfacher erscheinen. Das geringere Vorhandensein von Zwängen wird nämlich durch die Bedeutung ausgeglichen, die der Innovation und vor allem dem rechtzeitigen Nachweis, wie das Projekt tatsächlich zur Lösung des in der Aufforderung gestellten „Problems“ beitragen kann, beigemessen wird. Die folgenden Fragen müssen gestellt werden:
- Was genau ist das Problem, das wir angehen wollen?
- Warum hat es bisher noch niemand geschafft, das Problem zu lösen?
- Was ist das innovative (oder sogar bahnbrechende) Element meiner Idee im Vergleich zum aktuellen Stand der Technik?
- Welche Risiken sind mit meiner Innovation verbunden und wie schlage ich vor, sie zu bewältigen?
- Sind die erwarteten Ergebnisse glaubwürdig, messbar und mit den von mir geplanten Ressourcen erreichbar?
Ein Projekt ist besonders geeignet für einen Bottom-up-Aufruf, wenn:
- Die Idee schlägt eine höchst innovative Lösung für ein bestehendes Problem vor, die noch nicht formalisiert oder getestet wurde;
- Die Idee identifiziert ein spezifisches Problem, das in den durch den Aufruf definierten Makrobereich fällt;
- Das Projekt hat ein hohes Transformations- und Wirkungspotenzial mit der Möglichkeit der zukünftigen Skalierbarkeit und Replizierbarkeit
- Die vorschlagende Organisation ist in der Lage, ein Projekt zu entwickeln, das Strategien für den Umgang mit innovationsbezogenen Risiken enthält, z.B. mit flexiblen Aktivitäten und zwischenzeitlichen Verifizierungszeitpunkten.
Beim Bottom-up-Ansatz wird häufig Interdisziplinarität und Intersektoralität belohnt, d.h. die Fähigkeit eines Projekts, in mehreren Handlungsfeldern synergetisch an der Lösung eines gemeinsamen Problems zu arbeiten.
Beispiele für Top-down- und Bottom-up-Ansätze in europäischen Programmen
Es ist nicht immer einfach, „typische Fälle“ von Top-down- und Bottom-up-Ansätzen in europäischen Programmen zu identifizieren: Es handelt sich eher um eine „Skala der Nuancen“. Hier sind einige Beispiele.
Die nächste Generation der EU, die in Italien in einem Nationalen Plan für Wiederaufbau und Resilienz abgelehnt wurde, sieht 7 Missionen mit spezifischen Themenbereichen vor, mit der Definition von Zielen, d.h. von Ergebnissen, die von den Interventionen erwartet werden, die mit messbaren Indikatoren quantifiziert und innerhalb eines bestimmten Zeitraums erreicht werden sollen. Hinzu kommt ein System
In Kontexten wie Erasmus+ (dessen neuer Leitfaden für das Jahr 2026 vor kurzem veröffentlicht wurde) finden wir einen hybriden Ansatz: Der allgemeine Rahmen ist top-down, mit klar definierten Zielen, Prioritäten und transversalen Aspekten (wir haben dies hier diskutiert). Einige Aktionen, insbesondere die Leitaktion 1, enthalten jedoch auch Beispiele für Bottom-up-Ansätze. Dies ist der Fall bei der Aktion ‚Jugendbeteiligungsaktivitäten‘ (KA154), die junge Menschen in den Mittelpunkt des Entscheidungsprozesses stellt. Ziel ist es, Projekte zu unterstützen, die darauf abzielen, die Beteiligung junger Menschen am demokratischen Leben auf lokaler, regionaler, nationaler und europäischer Ebene zu stärken. Bei diesem Aufruf entstehen die Projekte aus den Ideen, Initiativen und dem Dialog der jungen Menschen selbst. Jugendbetreuer und Organisationen fungieren als Vermittler, aber der Motor des Projekts sind die Teilnehmer. Daher ist diese Aktion nicht nur für Organisationen, sondern auch für informelle Gruppen offen.
Ein weiteres Beispiel für einen hybriden Ansatz findet sich in Creative Europe, dem Vorzeigeprogramm der EU zur Finanzierung von Projekten im Kunst- und Kulturbereich. In den Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen für europäische Kooperationsprojekte werden zwei Hauptziele in Bezug auf die künstlerische Konzeption und das künstlerische Schaffen festgelegt: ein Ziel für das transnationale Schaffen und die grenzüberschreitende Verbreitung und ein Ziel für die Innovation, wobei jedoch ein großer Spielraum in Bezug auf den Inhalt und die Themen der Projekte gelassen wird. Diese Aufforderungen werden außerdem in kleiner, mittlerer und großer Größenordnung organisiert, wobei die Anforderungen an die Teilnahme steigen (Anzahl der Partner, Anzahl der beteiligten europäischen Länder, Höhe des Budgets), um auch kleineren und weniger strukturierten Organisationen eine Teilnahme zu ermöglichen (mehr über die organisatorische Kapazität und den Zugang zu europäischen Mitteln erfahren Sie hier und hier).
Es ist möglich, in Forschungs- und Innovationsprogrammen wie Horizon Europe Aufforderungen zu finden, die sehr stark auf den Bottom-up-Ansatz ausgerichtet sind. Ein Beispiel dafür ist der EIC Pathfinder Open, eine Horizon Europe-Aufforderung des Europäischen Innovationsrats (EIC), der wichtigsten Einrichtung der EU für die Identifizierung, Entwicklung und Verbreitung von Technologien und Innovationen. Die Aufforderung bietet multidisziplinären Teams Finanzmittel für Forschungsarbeiten, die das Potenzial zur Entwicklung bahnbrechender Technologien haben. Der Arbeitsplan 2026 des EIC mit Informationen über alle finanzierten Aufforderungen und Fristen für 2026 wurde kürzlich veröffentlicht und während des Infotags am 13. November 2025 öffentlich vorgestellt (eine Aufzeichnung der Veranstaltung finden Sie hier ).
Wir haben sowohl den Top-Down- als auch den Bottom-Up-Ansatz geprüft und gesehen, dass beide bei europäischen Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen von entscheidender Bedeutung sind. Beide haben ihre Stärken und Herausforderungen, die von einer Organisation, die sich für ein europäisches Projekt bewerben möchte, sorgfältig analysiert werden müssen. Der Schlüssel zum Erfolg ist jedoch bei beiden gleich: Wir müssen prüfen, ob unsere Idee und das Ziel der Förderorganisation wirklich übereinstimmen. Dies ist die einzige wirkliche Garantie, um nicht mit leeren Händen nach Hause zu gehen.