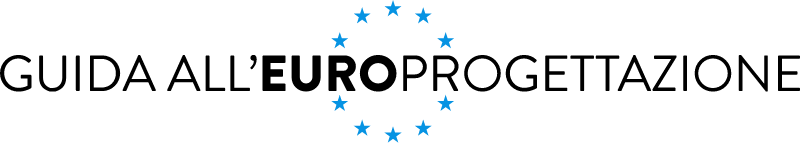Ein eingehender Blick auf die so genannten ‚transversalen Aspekte‘ im europäischen Design: Beispiele und Tipps, wie Sie diese in Ihre Projekte integrieren können
Querschnittsaspekte in europäischen Projekten: Was sind sie?
Wenn wir uns europäisches Design als Theaterstück vorstellen, können wir uns die Projekte als die Schauspieler, das Programm (oder die Ausschreibung) als das Drehbuch und die transversalen Aspekte als das Bühnenbild vorstellen. Die Querschnittsaspekte sind in der Tat der ‚Rahmen‘ des Entwurfs, aber wie bei einem Bühnenbild für ein Theaterstück sind sie viel mehr als nur ein Nebenelement: Sie sind eine Reihe grundlegender Themen, die mit den Prioritäten der EU-Politik verknüpft sind, die mit allen Aspekten des Projekts interagieren und darauf abzielen, sicherzustellen, dass jede mit europäischen Mitteln finanzierte Aktion zu gemeinsamen Werten und Herausforderungen beiträgt.
Querschnittsaspekte sind daher der Rahmen oder die „Kulisse“ eines jeden Projekts, aber sie sind auch ein wesentlicher Aspekt des Projekts. Sie sollten in jeder Phase integriert werden, von der Projektkonzeption bis zur Projektbewertung. Sie unterscheiden sich von den Zielen, die sich auf den spezifischen Bereich der Intervention beziehen und die (um die Metapher aufzugreifen) den „Schuss“ unseres Projekts darstellen.
Sie sind nicht nur ‚Absichtserklärungen‘, sondern erfüllen spezifische Anforderungen, die in europäischen Programmen und Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen enthalten sind.
Die wichtigsten übergreifenden Aspekte, die wir im europäischen Design finden, sind:
- Inklusion und Vielfalt. Die Projekte müssen zugänglich sein und die Teilnahme von Menschen mit geringeren Möglichkeiten fördern. Dabei müssen alle Formen der Diskriminierung in Bezug auf Geschlecht, Volkszählung, Herkunft, Orientierung und körperliche Verfassung (um nur einige zu nennen) bekämpft werden;
- Ökologische Nachhaltigkeit und der grüne Übergang. Die Projekte müssen in der Lage sein, so weit wie möglich Praktiken und Aktivitäten zu integrieren, die dazu beitragen, die Auswirkungen auf Ökosysteme und natürliche Ressourcen zu verringern, die Umwelt zu schützen und den Klimawandel zu bekämpfen;
- Digitaler Wandel und Innovation. Projekte sollten unabhängig von ihrem Einsatzbereich die Möglichkeit bieten, das Potenzial digitaler Technologien optimal zu nutzen, die digitalen Fähigkeiten der Teilnehmer zu verbessern und digitale Innovationen bei Methoden und Ergebnissen zu fördern;
- Bürgerliche und demokratische Beteiligung. Die Projekte sollen die Teilnahme am demokratischen Leben, ein größeres Wissen und Bewusstsein für die Grundwerte der EU und das soziale und politische Engagement der Bürger fördern.
Übergreifende Aspekte in europäischen Programmen
Diese transversalen Aspekte werden in den wichtigsten europäischen Programmen auf ähnliche Weise umgesetzt. Lassen Sie uns einige von ihnen analysieren.
Das Programm Erasmus+ bezieht sich auf die vier bereits erwähnten bereichsübergreifenden Prioritäten: Inklusion und Vielfalt, Umwelt und Bekämpfung des Klimawandels, digitale Transformation und demokratische Beteiligung.
Die offizielle Seite, die diesen Prioritäten gewidmet ist, präsentiert einige interessante Projektbeispiele für jede der Prioritäten in Form von kurzen Videointerviews. Der Leitfaden Unlock the power of priorities, der dieses Jahr veröffentlicht wurde, bietet praktische Tipps zur Integration von Prioritäten vor, während und nach dem Projekt, mit nützlichen Hinweisen auch außerhalb von Erasmus+ Projekten. Der INAPP-Leitfaden zu Inklusion und Vielfalt in Mobilitätsvorschlägen ist ebenfalls ein nützliches Anwendungsinstrument.
Im Strategieplan von Horizont Europa 2025-2027 wurden drei wichtige strategische Orientierungen (KSO) festgelegt:
- Grüner Übergang, wobei ein Querschnitt des Budgets von 10 Prozent für die biologische Vielfalt vorgesehen ist (zusätzlich zu dem Budget, das bereits speziell für Klimaschutzmaßnahmen vorgesehen ist);
- Digitaler Wandel: 13 Milliarden Euro sind zwischen 2021 und 2027 für digitale Schlüsseltechnologien vorgesehen;
- Ein widerstandsfähigeres, wettbewerbsfähigeres, integrativeres und demokratischeres Europa, eine Ausrichtung, die die Forschung zur zivilen Sicherheit, ein faires und umweltfreundliches Wirtschaftsmodell, Gesundheit und Wohlbefinden sowie demokratische Teilhabe umfasst.
Die KSOs wurden speziell für die zweite Säule des Programms, „Globale Herausforderungen und industrielle Wettbewerbsfähigkeit Europas“, und in Synergie mit der horizontalen Säule von Horizont Europa, „Ausweitung der Beteiligung und Stärkung des Europäischen Forschungsraums“, konzipiert(hier finden Sie einen Überblick über die Struktur und die Säulen des Programms).
Innerhalb der Strukturfonds stehen ganz ähnliche Dimensionen – und nicht etwa transversale Aspekte – im Mittelpunkt. Die„Verordnung über gemeinsame Bestimmungen„, die die einheitlichen Regeln für die Verwaltung der Strukturfonds festlegt, definiert 5 strategische Ziele oder „politische Ziele“ für die gesamte Programmierung(regionale Programme, nationale Programme und territoriale Zusammenarbeit):
- ein wettbewerbsfähigeres und intelligenteres Europa,
- ein widerstandsfähiges, grüneres und kohlenstoffarmes Europa,
- ein stärker vernetztes Europa, ein
- ein sozialeres und integrativeres Europa und
- ein bürgernahes Europa.
Diese Aspekte sind daher sowohl bereichsübergreifend als auch zentral für die Ausrichtung der Finanzierung. Sie werden normalerweise auch auf der Ebene der einzelnen Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen erwähnt, wobei je nach Aktionsbereich zusätzliche Anforderungen gestellt werden. Jede dieser bereichsübergreifenden Dimensionen ist in den Rahmen der europäischen Politik eingebettet, die (wie wir in unserem Handbuch erläutern) die Grundlage für Programme, Aufforderungen und Projektzuweisungen bildet.
Im Folgenden finden Sie eine kurze Analyse der wichtigsten Querschnittsaspekte mit einem Verweis auf die wichtigsten europäischen Politiken, auf die sie sich beziehen, sowie einige Hinweise, wie Sie sie am besten in Ihre eigenen Projekte integrieren können.
Inklusion und Vielfalt
Dies betrifft die soziale Gleichheit, den Grundsatz der Solidarität, die Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen, die Gleichstellung der Geschlechter, die Achtung von Minderheiten und die Vielfalt in all ihren Erscheinungsformen.
Im Mittelpunkt der Inklusion steht die Akzeptanz der Merkmale, die jeden Menschen einzigartig machen, während Diversität die inhärente Vielfalt einer Gesellschaft beschreibt, die sich in der Anerkennung von Unterschieden zwischen Individuen aufgrund von Faktoren wie Alter, Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit, religiöser Überzeugung, Behinderung, sexueller Orientierung, Bildungsniveau und Nationalität manifestiert.
Die Integration dieses Prinzips in die Projekte basiert auf dem Konzept „Leave No One Behind“, d.h. es wird sichergestellt, dass niemand vor, während und nach dem Projekt zurückgelassen wird, indem physische, kulturelle, soziale, wirtschaftliche und geographische Hindernisse für die Teilnahme so weit wie möglich beseitigt werden.
Die Politik- und Strategiedokumente der EU, die dieses Prinzip untermauern, sind:
- den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere Artikel 2;
- die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, in der die Werte Würde, Freiheit, Gleichheit, Solidarität, Staatsbürgerschaft und Gerechtigkeit betont werden;
- Die Europäische Säule sozialer Rechte, die 20 Grundsätze für einen besseren und gerechteren Zugang zum Arbeitsmarkt, faire Arbeitsbedingungen, sozialen Schutz und Eingliederung umfasst.
Darüber hinaus gibt es die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK), die 1950 von den 46 Mitgliedstaaten des Europarats, darunter die 27 EU-Mitgliedstaaten, zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten in Europa verabschiedet wurde.
Was die Inklusion von Menschen mit Behinderungen betrifft (ein Thema, das wir in einem kürzlich erschienenen Artikel erörtert haben), so ist ein Schlüsseldokument die Strategie für die Rechte von Menschen mit Behinderungen 2021-2030, die auf dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UNCRPD) basiert. Es ist auch wichtig, das Europäische Gesetz zur Barrierefreiheit zu berücksichtigen, das ab Juni 2025 in Kraft tritt.
Darüber hinaus ist es sinnvoll, sich auf die Prioritäten der Europäischen Kommission für 2024-2029 zu beziehen, insbesondere auf die Priorität„Unterstützung der Menschen und Stärkung unserer Gesellschaften und unseres Sozialmodells“ sowie auf die Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung, die in der Aktion „Aufbau einer Union der Gleichstellung“ enthalten sind.
Wenn Sie sich eingehender über die Gesetzgebung informieren möchten, empfehlen wir Ihnen die Website EUR-Lex, einen offiziellen Zugang zur EU-Gesetzgebung. In der Rubrik‚Zusammenfassungen der EU-Gesetzgebung‚ finden Sie kurze Übersichten mit Links zu Referenzdokumenten, die nach 32 Themenbereichen geordnet sind. Für den Bereich Integration und Vielfalt empfehlen wir Ihnen den Abschnitt über Menschenrechte, den Abschnitt über Justiz, Freiheit und Sicherheit sowie den Abschnitt über Beschäftigung und Sozialpolitik.
Eine weitere Referenzquelle für aktuelle Informationen über konkrete Maßnahmen der Europäischen Kommission ist die Website der Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und Integration (GD EMPL), die einen Abschnitt über die Politiken und Aktivitäten enthält, für die die Generaldirektion zuständig ist.
Hier sind einige Tipps für ein integratives Projekt:
- Bemühen Sie sich um eine faire Vertretung der Unterschiede im Projektteam und bei den Zielgruppen;
- Erkundigen Sie sich aktiv nach den Bedürfnissen der Empfänger entsprechend ihren Unterschieden, um die am besten geeignete Unterstützung in Betracht zu ziehen;
- Denken Sie nicht nur an die Hindernisse, sondern auch an den Beitrag, den die Empfänger gerade wegen ihrer Vielfalt zu dem Projekt leisten können.
Gleichberechtigung der Geschlechter
Dieses Prinzip ist Teil des umfassenderen Prinzips der Inklusion und Vielfalt, aber angesichts seines zunehmenden Gewichts im europäischen Design widmen wir ihm eine eingehendere Studie.
Geschlechtergleichstellung bedeutet „gleiche Rechte, Pflichten und Chancen für Frauen und Männer, Mädchen und Jungen“ (EIGE). Die Gleichstellung der Geschlechter bezieht sowohl Männer als auch Frauen mit ein und sorgt für gleichen Zugang in 6 Schlüsselbereichen, die im Gleichstellungsindex definiert sind: Arbeit, Geld, Wissen, Zeit, Macht, Gesundheit.
Was die Gleichstellung der Geschlechter betrifft, so sind die wichtigsten Referenzen auf EU-Ebene:
die Charta der Grundrechte der Europäischen Union(Art. 23);
den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV, Artikel 8 und 157);
Die EU-Strategie ‚Eine Union der Gleichstellung: Die Strategie für die Gleichstellung von Frauen und Männern 2020-2025‚, die fünf vorrangige Aktionsbereiche festlegt.
Wir weisen auch auf den Fahrplan zur Stärkung der Frauenrechte hin, der im Rahmen der Prioritäten 2024-2029 der Europäischen Kommission entwickelt wurde und Links zu weiteren Dokumenten und Quellen enthält, wie z.B. dem Jahresbericht zur Gleichstellung der Geschlechter in Europa (verfügbar für 2025).
Im Rahmen europäischer Ausschreibungen wird dies in Anforderungen wie der Vorlage eines Gleichstellungsplans (GEP) umgesetzt, der zu den obligatorischen Anforderungen von Horizont Europa gehört, sowie in der Förderung des Gender Mainstreaming. Der GEP ist ein strategischer und organisierter Plan zur Förderung und Gewährleistung der Gleichstellung der Geschlechter im Arbeitsumfeld von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen. Gender Mainstreaming in Projekten hingegen bedeutet die systematische Berücksichtigung der Unterschiede zwischen Frauen und Männern in allen Projektphasen.
Oberstes Ziel ist es, die Gleichstellung von Frauen und Männern zu fördern und Diskriminierung zu bekämpfen, um sicherzustellen, dass alle gleichermaßen von den ergriffenen Maßnahmen profitieren und dass Ungleichheiten nicht fortbestehen.
Drei Tipps für ein geschlechtergerechteres Projekt:
- versuchen Sie, ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis im Projektteam und auf den verschiedenen Entscheidungsebenen sicherzustellen;
- Beziehen Sie die Geschlechterperspektive in die Kontext- und Bedarfsanalyse in der Entwurfsphase ein;
- geschlechtsspezifisch aufgeschlüsselte Daten und spezifische Indikatoren für die Projektüberwachung und -bewertung enthalten.
Digitaler Wandel und Innovation
Der digitale Wandel ist eine Strategie zur Entwicklung einer digitalen Transformation zum Wohle aller, mit einem Ansatz, der den Menschen und die europäischen Werte in den Mittelpunkt stellt. Nach den Vorstellungen der EU muss der digitale Wandel in der Lage sein, die Technologie in den Dienst der Menschen zu stellen, zu einer gerechten und wettbewerbsfähigen Entwicklung der digitalen Wirtschaft zu führen, sichere, zugängliche und integrative digitale Räume zu schaffen und Maßnahmen für mehr ökologische Nachhaltigkeit zu unterstützen.
Europäische Politik und offizielle Referenzdokumente sind:
- den Digitalen Kompass 2030, der strategische Ziele für das digitale Jahrzehnt definiert;
- die Europäische Erklärung zu den digitalen Rechten und Grundsätzen für das digitale Jahrzehnt, die einen digitalen Wandel fördert, der den Menschen in den Mittelpunkt stellt und auf den Werten der EU basiert (wir haben hier darüber gesprochen);
- Auf gesetzgeberischer Ebene möchten wir für seine innovativen Aspekte die Verordnung über künstliche Intelligenz (KI-Gesetz) hervorheben, das erste Gesetz der Welt, das harmonisierte Standards für KI auf der Grundlage eines risikoorientierten Ansatzes (inakzeptables, hohes, begrenztes, minimales Risiko) festlegt.
Auf der EUR-Lex-Website können Sie über die Unterrubrik Forschungs- und Innovationspolitik eine Reihe von Links zu Referenzdokumenten aufrufen, darunter das Programm Digitales Europa 2021-2027.
Vom Standpunkt der politischen Maßnahmen aus betrachtet, sind Digitalisierung und Innovation eine der bereichsübergreifendsten Dimensionen, aber für spezifische Erkenntnisse sind die GD Connect und die Exekutivagentur HADEA am stärksten beteiligt. Einen Überblick über die politischen Maßnahmen im Bereich der digitalen Gesellschaft, fortschrittlicher digitaler Technologien (einschließlich künstlicher Intelligenz), internationaler Zusammenarbeit im digitalen Bereich und der digitalen Wirtschaft finden Sie auf der Website der GD Connect.
Drei Tipps für ein Projekt, das zum digitalen Wandel beiträgt:
- in der Entwurfsphase versuchen, den digitalen Aspekt der Aktivitäten von Anfang an einzubeziehen, anstatt digitale Komponenten erst später zu integrieren, um die Anforderungen der Ausschreibung zu erfüllen;
- Monitoring-Indikatoren enthalten, die die digitale Komponente sowohl aus der Perspektive der Aktivitäten als auch des Projektmanagements abdecken;
- integrierte digitale Messung der Nachhaltigkeit durch den Versuch, die Verringerung der Umweltauswirkungen eines Projekts durch die Einführung digitaler Lösungen (z. B. Energie-/Emissionsreduzierung) zu quantifizieren, um zu zeigen, wie der digitale Wandel ein Katalysator für den grünen Wandel ist.
Ökologische Nachhaltigkeit und grüner Wandel
Ökologische Nachhaltigkeit ist das Prinzip, das ein langfristiges ökologisches Gleichgewicht sicherstellt, das die aktuellen Bedürfnisse erfüllt, ohne künftige Generationen zu gefährden. Sie ist in sechs Schlüsselzielen verankert: Eindämmung des Klimawandels und Anpassung, nachhaltige Ressourcennutzung, Kreislaufwirtschaft, Bekämpfung der Umweltverschmutzung und Schutz der biologischen Vielfalt. Die Green Transition ist die politische Strategie der EU, die den Fahrplan für die Umsetzung dieses Wandels festlegt. Ein Prozess, der einen tiefgreifenden und weitreichenden Wandel auf wirtschaftlicher, politischer, sozialer und kultureller Ebene voraussetzt.
Zu den relevanten europäischen Politiken gehören:
- den Europäischen Green Deal und die entsprechende Mitteilung der Europäischen Kommission;
- Europäisches Klimaschutzgesetz, in dem das Ziel verankert ist, die Netto-Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55% gegenüber dem Niveau von 1990 zu reduzieren, begleitet von dem Gesetzespaket ‚Fit for55‚ zur Umsetzung dieses Ziels;
- EU-Taxonomieverordnung, ein eher technisches Dokument, das jedoch die operativste Definition dafür liefert, was eine ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeit ist.
Die Bedeutung dieses Grundsatzes spiegelt sich auch im neuen mehrjährigen Finanzrahmen 2028-2034 wider (dem neuen Haushaltsvorschlag der Europäischen Kommission, den wir hier erörtert haben), der vorsieht, mindestens 35 Prozent der Mittel auszugeben, um Fortschritte bei den im Green Deal festgelegten Zielen zu erzielen.
Im Rahmen der Prioritäten 2024-2029 der Europäischen Kommission enthält die Seite, die der Priorität‚Erhaltung der Lebensqualität: Lebensmittelsicherheit, Wasser und Natur‚ gewidmet ist, nützliche Einblicke sowie eine Zeitleiste der Fortschritte in Bezug auf politische Maßnahmen, legislative Aktionen und Initiativen. Darüber hinaus finden Sie auf der EUR-Lex-Website eine Zusammenfassung der europäischen Umwelt- und Klimagesetzgebung mit Links zu Referenzdokumenten.
Darüber hinaus gibt es eine Reihe strategischer Dokumente mit spezifischeren Schwerpunkten wie die EU-Strategie zur biologischen Vielfalt 2030 und die Verordnung zur Wiederherstellung der Natur oder im Agrar- und Ernährungssektor die Strategie „Vom Bauernhof bis zum Teller“ (die wir kürzlich in diesem Artikel im Food for Europe-Podcast besprochen haben).
Aspekte des Klimas und der ökologischen Nachhaltigkeit werden insbesondere von der Generaldirektion Klimapolitik, GD CLIMA, im Hinblick auf die Bekämpfung des Klimawandels behandelt, wobei Elemente mit anderen Direktionen wie der GD AGRI, die für den Agrarsektor zuständig ist, und der GD ENER, die für den Energiesektor verantwortlich ist, geteilt werden. Eine Auswahl von Links zu politischen Maßnahmen, Initiativen und thematischen Einblicken finden Sie auf den Homepages der Direktionen.
Es gibt zahlreiche Anforderungen in den Ausschreibungen, die sich auf die ökologische Nachhaltigkeit beziehen, in einigen Fällen sehr bedingte, wie z.B. die verstärkte Cross-Compliance, ein System verbindlicher Vorschriften, das die Einhaltung der obligatorischen Bewirtschaftungskriterien (SMR) verlangt, und die Vorschriften für die Erhaltung von Flächen in gutem landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand (GLÖZ) für Landwirte, die Mittel aus der Gemeinsamen Agrarpolitik erhalten (wir widmen der GAP und den Fonds für den ländlichen Raum in diesem Leitfaden viel Platz ).
Drei Tipps für ein europäisches Projekt, das zum grünen Übergang und zur ökologischen Nachhaltigkeit beiträgt:
- Maßnahmen, auch kleine, die dazu beitragen, den ökologischen Fußabdruck Ihres Projekts zu verringern, z. B. durch die Verwendung von Transportmitteln mit geringerer Umweltbelastung, die Festlegung von Standards zur Abfallvermeidung, die Reduzierung von Plastik usw;
- erwägen Sie die Aufnahme spezifischer Überwachungsindikatoren, um den Grad der ökologischen Nachhaltigkeit des Projekts zu messen;
- entwickelt Maßnahmen zur Förderung eines tugendhaften Verhaltens auch auf Seiten der Projektempfänger, z. B. durch die Bereitstellung eines angemessenen Budgets für Reisen mit einem geringeren CO2-Fußabdruck.
Bürgerliche und demokratische Beteiligung
Das Schlüsselwort in diesem übergreifenden Aspekt ist Partizipation, verstanden als die Möglichkeit der Menschen, sich auszudrücken und zu Entscheidungen beizutragen, die Auswirkungen auf ihr Leben haben. Dieser Grundsatz bezieht sich auf die Möglichkeit der Teilnahme am demokratischen Leben auf allen Ebenen, auf lokaler, nationaler und europäischer Ebene, durch sinnvolle Gelegenheiten, bei denen die Teilnehmer ihre Ansichten zum Ausdruck bringen können, was dazu beiträgt, ein größeres Gefühl der Zugehörigkeit zur europäischen Gemeinschaft zu entwickeln. Als übergreifender Aspekt geht es auch um die Fähigkeit eines Projekts, kritisches Denken, Medienerziehung, staatsbürgerliche und interkulturelle Kompetenzen sowie das Verständnis für gemeinsame EU-Werte zu fördern. In diesem Rahmen ist die Beteiligung der Jugend ein Schlüsselaspekt, ein Thema, das wir in diesem Artikel auch mit unserem technischen Partner Europiamo diskutiert haben.
Zu den wichtigsten Referenzen aus der Perspektive der Gesetzgebung und der europäischen Politik gehören:
- Der Vertrag über die Europäische Union, insbesondere die Artikel des Titels II – Bestimmungen zu den demokratischen Grundsätzen (Art. 10, 11 und 12);
- In der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, insbesondere in Titel V über die Unionsbürgerschaft, sind die für die Teilhabe wesentlichen bürgerlichen und politischen Rechte festgelegt;
- Empfehlung (EU) 2023/2836 zur Förderung der Einbeziehung und wirksamen Beteiligung von Bürgern und Organisationen der Zivilgesellschaft an öffentlichen Entscheidungsprozessen;
- Die Jugendstrategie der Europäischen Union 2019-2027 widmet sich der Einbeziehung junger Menschen.
Dieses Thema steht im Mittelpunkt der strategischen Agenda der Europäischen Kommission. Eine der Prioritäten für den Zeitraum 2024-2029 konzentriert sich auf den Schutz der Demokratie und der europäischen Werte. Auf der dieser Priorität gewidmeten Seite können Sie sich nicht nur einen Überblick über die verschiedenen Bereiche verschaffen, in denen diese Priorität abgelehnt wird (von der Pressefreiheit bis zur Medienkompetenz über Maßnahmen wie eine verstärkte Konditionalität), sondern auch auf nützliche Erkenntnisse wie den Bericht 2025 über die Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union zugreifen .
Schließlich können Sie auf der EUR-Lex-Website in der Rubrik „Justiz, Freiheit und Sicherheit“ eine Übersicht über Links zu Referenzdokumenten aufrufen, insbesondere im Unterabschnitt „Unionsbürgerschaft“.
Drei Tipps für ein europäisches Projekt, das zur bürgerlichen und demokratischen Beteiligung beiträgt:
- Ziehen Sie die Möglichkeit in Betracht, dass die Projektnehmer direkt zu den Aktivitäten beitragen können, z.B. durch Co-Design oder bürgerschaftliche Überwachungsaktionen (wir haben dies hier diskutiert);
- Wenn Sie über das Projekt kommunizieren, sollten Sie, wenn möglich, auch Aktivitäten zur Unterstützung der Bürger, öffentliche Diskussionsveranstaltungen und zugängliches Material zur Verbreitung einbeziehen;
- Stellen Sie sicher, dass das Projekt so strukturiert ist, dass es die notwendigen Informationen liefert und den Empfängern einen sicheren Raum bietet, in dem sie sich austauschen und ihre Meinung äußern können.
Transversale Aspekte: der wahre Schlüssel zur Wirkung?
Wir haben gesehen, was bereichsübergreifende Aspekte sind, woher sie in Bezug auf europäische Werte und Politiken kommen, wie sie in Projekte integriert werden können und wie sie sich in spezifischen Prioritäten und Anforderungen in europäischen Programmen niederschlagen.
Querschnittsaspekte sind keine bloßen bürokratischen Anforderungen, sondern echte Katalysatoren der Wirkung: Wenn sie richtig integriert sind, erhöhen sie nicht nur die Chancen auf eine Finanzierung, sondern steigern auch das transformative Potenzial des einzelnen Projekts, indem sie die Abstimmung zwischen europäischer Politik, Programmplanung und Projekten stärken.
Wir werden in den kommenden Monaten auf die Elemente dieser ‚Szenografie‘ zurückkommen und Einblicke, Werkzeuge und Erfahrungen zu den einzelnen Querschnittsaspekten vorstellen.